Am 14. Oktober gedenkt die katholische Kirche des heiligen Burkard, des ersten Bischofs des Bistums Würzburg. Die Gläubigen rufen ihn um Hilfe an insbesondere bei Gelenkschmerzen und Rheumatismus, bei Stein- bzw. Nierenleiden und Stechen in der Lende. Dies verwundert nicht, denn er hat sich der Legende nach im Alter in eine kalte und feuchte Höhle in Homburg am Main zurückgezogen. Er suchte Ruhe. So steckt ein Stück Ironie darin, dass nun ausgerechnet ein Musiker und Sammler historischer Tasteninstrumente seit genau 20 Jahren alles daran setzt, das Schloss über dieser Burkardusgrotte aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken und mit pulsierendem Leben zu füllen – mit respektablem Erfolg.

Burkard war angelsächsischer Mönch, verbrachte wohl die ersten Jahre auf dem Festland in der Benediktinerabtei in Neustadt zwischen Lohr und Marktheidenfeld. Sein Landsmann Bonifatius, der „Apostel der Deutschen“, setzte ihn 742 als Würzburger Oberhirten ein. Der Name Burkard bedeutet starker Schützer.
Auf einer Visitationsreise soll Burkard von Glaubensfeinden und Wegelagerern verfolgt worden sein: Vor Anbruch der Nacht erreichte er die „Hohenburg“ auf einem steil aufragenden Felsen aus Tuffstein. Sicherer fühlte er sich in einer abgelegenen Tropfsteinhöhle. Doch am Morgen gelangten die Häscher auch hierher. Einer von ihnen erblickte den schmalen Zugang. In diesen hatte eine Spinne ihr Netz gewebt, in dem Tautropfen hingen. Hier könne in jüngster Zeit niemand gewesen sein, folgerte er und drehte ab.
Burkard war auf wunderbare Weise gerettet worden. Er kehrte später an diesen Ort zurück. 754 soll er in seiner selbst gewählten Klausur friedlich gestorben sein. 986 wurden seine Gebeine in die Bischofsstadt überführt.


Der älteste schriftliche Beleg über die Homburger Burkardusgrotte stammt von 1649. Die kirchliche Weihe erhielt sie 1721; nach einer angeblichen Wunderheilung strömten die Pilger. Da war die einstige Trutzburg auf dem Felssporn darüber, die ab der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts am Rand des Hochstifts Würzburg gegenüber der Grafschaft Wertheim als Verkehrs- und Wirtschaftsstützpunkt die Handelswege sicherte, schon in ein Schloss als Sitz der „Amtsleute“ umgewandelt. Ritter Philipp von Gebsattel hatte damit 1568 begonnen und eine direkt auf der Grotte errichtete gotische Kirche mit Fachwerk aufstocken lassen. Diese Kirche wurde nach dem Bau einer neuen profaniert.

Anfang des 19. Jahrhunderts fiel der Bezirk Homburg ans neugegründete Königreich Bayern. Bald verlor der Ort seine behördliche Bedeutung durch den Wegzug des Landgerichts und des Finanzamts. 1869 erwarb die Gemeinde das Schloss, nutzte es als Pfarrhaus, Schule und Rathaus. Bei der bayerischen Gebietsreform von 1972 wurden Homburg, Lengfurt, Rettersheim, Trennfeld und Kloster Triefenstein zum Markt Triefenstein vereint. Das Schloss in seiner bisherigen Funktion wurde nicht mehr gebraucht.
Kunst rettet das Bauwerk
Sogar Mitglieder des Marktgemeinderats sollen sich geäußert haben, gerne den Sprengstoff zu spendieren, um das alte Gemäuer zu beseitigen. Der „Verein zur Rettung von Schloss Homburg“ wusste dies zu verhindern. Besonders engagierte sich Heinz Otremba, langjähriger Leiter des Fränkischen Volksblatts; nach der Vertreibung 1945 aus Oberschlesien hatte seine Familie Aufnahme in Homburg gefunden. Otremba und Bürgermeister Jürgen Nolte sowie dessen Vorgänger Lothar Huller seien 1997/98 seine mächtigsten Fürsprecher gewesen, um mit Kunst ein vielseitig interessierte Publikum ins Schloss zu holen, zeigt sich Michael Günther überzeugt. Er, der studierte Musiker mit einem besonderen Hang zu feinen Tasteninstrumenten des 17. und 18. Jahrhunderts und folglich großen Platzbedarf, und seine damalige Lebensgefährtin, die Malerin Gertrude E. Landenkammer, erhielten den Vorzug im „Wettstreit“ potenzieller Mieter – und Instandsetzer. „Unter anderem konnten wir uns gegen einen Herrn mit schnittigem Wagen aus dem Rhein-Main-Gebiet in Begleitung dreier ‚Kissenstickerinnen’ durchsetzen“, berichtet Günther süffisant. Auch kann er sich noch gut erinnern, wie er, um sein neues Zuhause stilecht herrichten zu können, in der „Ex-DDR“ auf Schatzsuche ging und dort beispielsweise entsprechende Türbeschläge erwarb.

Michael Günther versteht es, wahrhaft unterhaltsam zu erzählen. So trägt zum Unterhalt neben seiner Konzerttätigkeit ganz wesentlich dazu bei, dass er bis zu 80 Mal pro Jahr Flusskreuzfahrer – meist von Wertheim kommend – zu musikalischen Führungen auf Schloss Homburg begrüßt. Oft sind es Gäste aus Australien und Amerika, die so betagte Cempali und Klaviere, wie er sie sein Eigen nennt, aus ihrer Heimat nicht kennen. „Ich bin jetzt bei 30 Stück“, stellt er selbstzufrieden fest. Die führt er zwar nicht alle seinen internationalen Gästen vor. Aber ganz wichtig ist das älteste Exemplar: ein Cembalo von Giacomo Ridolfi, das dieser um 1665 für die Papstfamilie Rospigliosi fertigte; der Korpus besteht aus fünf Millimeter starkem Zypressenholz. Auf 1690 ist ein weiteres Cempalo aus Neapel datiert. 1785 fertigte Ferdinand Hofmann in Wien seinen Hammerflügel Nr. 1. Ein Pantaleon, eines der ältesten deutschen Klaviere (um 1815), stammt aus Stuttgart, ein „Giraffenflügel“ aus Bamberg, …


„Jede Zeit bildet sich ihren eigenen Ton“, doziert der Experte, der zuletzt auch eine vielbeachtete Ausstellung im „vorarlberg mueseum“ in Bregenz kuratierte. „Die Musikinstrumente verraten durch ihren Ton und ihre Spielmöglichkeiten unter anderem, welche Ästhetik, welche kompositorischen Formen und welche Musiziergewohnheiten vorherrschten.“ Beispielsweise habe man sich Mitte des 18. Jahrhunderts nach mehr Freiheit, Natürlichkeit und Einfachheit in den Künsten und in der allgemeinen Lebensart gesehnt.
Clavier am Main lädt ein
Da Michael Günther seine Instrumente als Gebrauchsgegenstände betrachtet und alle unterschiedlich bespielt werden, bedeutet dies für ihn: bis zu sechs Stunden täglich üben. Zusätzlich gibt er Kurse und ein gutes Dutzend Konzerte im Jahr. Der Stucksaal des Homburger Schlosses fasst rund 75 Personen. „Niemand wird weggeschickt“, sagt Michael Günther. „Im Falle eines Falles bieten wir Kissen an.“ Die Veranstaltungen kündigt er auf seiner Internetseite www.clavier-am-main.de an.
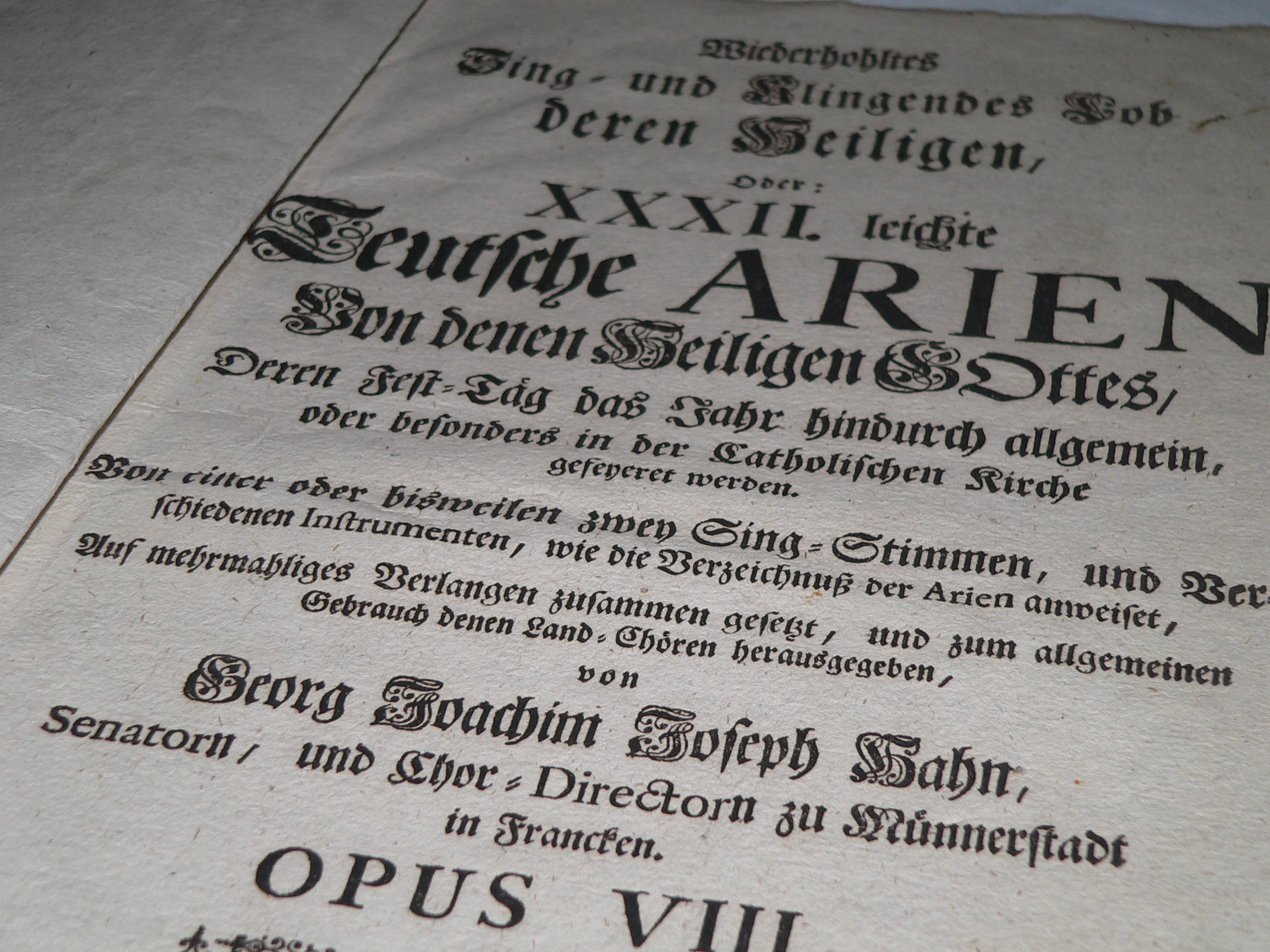
Museum und Manufaktur
Noch anderes lockt nach Homburg. Zum Beispiel die Papiermühle von 1807. Sie ist zugleich lebendiges Museum und moderne Manufaktur. Bis Monatsende läuft dort noch die Ausstellung „Papier – unARTig“. Sogar die Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes der Menschheit wird angestrebt.
Bekannt ist Homburg vor allem für seine beiden Weinlagen – die „Edelfrau“ und den „Kallmuth“. Erdig-feurige Tropfen mit zartem Mandelgeschmack sollen hier reifen. Seit 2012 erntet der Musiker Michael Günther mithilfe seines Freundes und Winzers Alfred Blank selbst jährlich 300 bis 400 Liter aus einem sogenannten gemischten Satz bestehend aus Riesling, Elbling, Muskateller, Blauer Silvaner und weiteren Rebsorten. Der gelingt meist auch mit Unterstützung des Orts- und Diözesanheiligen. Denn: „St. Burkardi Sonnenschein, schüttet Zucker in den Wein.“


